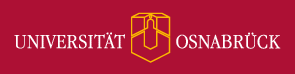Hauptinhalt
Topinformationen

Sektion IV Wendepunkte: Wann und warum wird Frieden (wieder) möglich?
Sektion IV
Wendepunkte: Wann und warum wird Frieden (wieder) möglich?
Dr. Dorothée Goetze, Universität Bonn
Dr. Lena Oetzel, Universität Bonn
„Weil es iedoch anderst nit sein könden" - Friedensfindung zwischen Prinzipien und politischem Pragmatismus am Beispiel Kursachens und des Kaisers während des Westfälischen Friedenskongresses
Wann und warum wird Frieden möglich? Diese, der Sektion leitend voran gestellte Frage zielt sowohl auf den Prozess der Friedensfindung als auch auf deren politische und soziale Rahmenbedingungen sowie deren inhaltliche Konjunkturen. All diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und wirken somit in unterschiedlichem Maße auf Friedensfindung. Sie finden ihren expliziten Niederschlag in Bedingungen für die Friedensbereitschaft der Verhandelnden.
Friedensfindung meint einen (Minimal-)Konsens: handlungsleitende Prinzipien wie politische Interessen oder ideelle Aspekte müssen ausbalanciert werden. Der Ausgleich solcher Prinzipien kann durch politischen Pragmatismus gelingen bzw. umgekehrt kann die Verweigerung von pragmatischen Lösungen den Ausgleich und somit die Friedensfindung verhindern.
An zwei Beispielen aus unterschiedlichen Phasen der Verhandlungen des Westfälischen Friedenskongresses soll das Verhältnis zwischen Prinzipien und Pragmatismus untersucht werden.
Das Festhalten des Kaisers an Verhandlungen mit Frankreich in Münster in der Schlussphase des Westfälischen Friedenskongresses manövrierte seine Gesandten ins Abseits, so dass der Frieden faktisch zwischen den Franzosen und den reichsständischen Vertretern ausgehandelt wurde.
Aber nicht nur verhandlungstechnisch, auch inhaltlich war die kaiserliche Politik von Prinzipientreue geprägt. Erst die reale Drohung, aus dem Frieden ausgeschlossen zu werden, ließ die Entscheidungsträger am Kaiserhof umlenken und bis dahin gehegte politische Interessen aufgeben.
Die kursächsischen Gesandten wiederum befanden sich bereits mit ihrem Eintreffen in Osnabrück im Verhandlungsabseits, da ihnen Kurfürst Johann Georg I. verwehrte, das Kursachsen zustehende Direktorium der protestantischen Stände zu übernehmen. Nur widerstrebend hatte er überhaupt eine Gesandtschaft nach Westfalen geschickt; für ihn galt der Prager Frieden und er wollte es vermeiden, mit den seiner Meinung nach unangemessenen Forderungen der übrigen protestantischen Stände in Verbindung gebracht zu werden. In Folge konnten seine Gesandten aus Gründen der Präzedenz nicht an den protestantischen Beratungen teilnehmen, sie waren auf Informationen Dritter angewiesen. Das Handeln der kursächsischen Gesandten zeugt von dem Versuch, die Prinzipientreue des Kurfürsten subtil und pragmatisch zu unterlaufen und somit ihren Handlungsspielraum zu erweitern.
Die beiden Beispiele – Kaiser und Kursachsen – nehmen das Spannungsfeld von Prinzipien und Pragmatismus als Hindernis zum Frieden aus unterschiedlichen Perspektiven in den Blick: Während im ersten Beispiel stärker der Herrscher im Fokus steht, der sich von seinen Prinzipien trennen und dabei sein Gesicht wahren musste, betrachtet das kursächsische Beispiel die Gesandten und ihren Umgang mit herrscherlichen Prinzipien. Beide Ebenen sind unerlässlich für die Frage, wann, warum und wie Frieden möglich wird.
Prof. Dr. Gerhard Hirschfeld, Universität Stuttgart
Endspiel: Die Ursachen der deutschen Niederlage 1918
Am 29. September 1918 gestand die Dritte Oberste Heeresleitung (OHL) widerwillig ein, dass eine Fortsetzung des Krieges nicht mehr möglich sei und forderte deshalb die (neu zu berufende) Reichsregierung auf, umgehend Friedensgespräche mit den Alliierten zu beginnen. Anstoß für diese überraschende Entscheidung der militärischen Führung des Deutschen Reiches war der Zusammenbruch der sog. Saloniki-Front auf dem Balkan, hervorgerufen durch Bulgariens Verlassen des Bündnisses mit den Mittelmächten sowie Österreich-Ungarns ohne Absprache mit seinem wichtigsten Verbündeten erfolgte Friedens-Demarche an die Alliierten Mitte September – faktisch die Aufkündigung des Bündnisses. Für die Alliierten war damit der Weg zur Donau frei.
Welche Absichten Hindenburg und Ludendorff mit ihrem Eingeständnis einer offenkundigen Niederlage des Reiches verfolgten, ist bis heute nicht vollständig geklärt: Handelte es sich um eine spontane Verzweiflungstat (quasi aus Mangel an Alternativen), um die Suche nach einer temporären „Waffenruhe“ (gleichsam noch auf dem Schlachtfeld), um dem Heer die dringend benötigte Ruhepause zu verschaffen, oder die politische Überantwortung der Friedenssuche an die verhassten Zivilisten in der Verfolgung einer bereits umlaufenden Dolchstoßlegende?
Das deutsche Angebot zu „Friedensverhandlungen“ stellte für die Alliierten eine kapitale Überraschung dar, für die deutsche Öffentlichung war es ein gewaltiger Schock. Das deutsche Heer schien, nach den schweren Niederlagen im Juli und August zwar geschwächt, aber es war keineswegs besiegt: seine Truppen standen immer noch weit auf feindlichem Gebiet – im Westen wie im Osten. Die Reaktionen an der „Heimatfront“ des Reiches waren ebenso vielfältig wie widersprüchlich. Vor allem machen sie deutlich, dass der wachsende Verlust einer Siegeszuversicht noch keineswegs eine klare Einsicht in die militärische Niederlage bedeutete. Es fehlte schlicht die gemeinsame Sprache für einen Kompromißfrieden.
Dabei hätte die innere Verfassung des deutschen Heeres nach der letztlich gescheiterten Frühjahrsoffensive im Westen Aufschluß geben können über die Aussichten des Krieges. Die hochgeputsche Euphorie, mit der viele Soldaten die Frühjahrsoffensive(n) begrüßt hatten, machte einer zunehmenden Ernüchterung und schließlich weit verbreiteten Resignation Platz. In den Monaten August und September wurden schätzungsweise ca. 750.000 deutsche Soldaten als „abwesend“ geführt. Es war eine Art „Fluchtbewegung“, die sich auf dem Weg von der Front in die Heimat oder zur Etappe respektive zwischen Front und den rückwärtigen Sanitätsdiensten abspielte. Nach Einschätzung der OHL war dies ebenfalls ein „Dolchstoß“, für den „bolschewistische Zersetzungspropaganda“ verantwortlich gemacht wurde. Wie die Ego-Dokumente der Soldaten ausweisen, war die Mehrzahl der Soldaten schlicht kriegsmüde. Weder die als stabilisierend betrachtete Kameradschaft noch die Existenz relativ homogener Primärgruppen vermochten diesem Prozeß entgegen zu wirken.
Die Ursachen der deutschen Niederlage wurzeln in einer permanenten Selbstüberschätzung der militärischen wie der politischen Führung des Reiches, in einem kompromißlosen Insistieren auf einem „Siegfrieden“ sowie einer zunehmenden Entfremdung zwischen Front und Heimat. Die „Januarstreiks“ waren zwar nicht die Generalprobe für die revolutionären Ereignisse im Spätherbst 1918, aber bereits ein Menetekel der politischen und gesellschaftlichen Erosionen, die von den Verantwortlichen ebenso fahrlässig wie selbstzerstörerisch ignoriert wurden.
Die von Reinhard Koselleck benannten Schlüsselkategorien „Erfahrungsraum“ und „Erwartungshorizont“ treffen auch auf das Jahr 1918 und die deutsche Niederlage zu. Der Erfahrungsraum des Weltkriegs und Erwartungshorizont für die Zeit danach ließen sich weder in Deutschland noch bei seinen Kriegsgegnern in Einklang bringen. Deshalb bietet sich hier eine weitere Kategorie an: Enttäuschung – und zwar auf allen Seiten.
Prof. Dr. Marie-Janine Calic, LMU München
„Dayton - Mythos oder Modell?“
Als der Bosnienkrieg im Herbst 1995 mit dem Dayton-Abkommen nach mehr als drei Jahren endlich zu Ende ging, herrschte international große Euphorie. Der Friedensschluss wurde als Erfolg militärischer Intervention der NATO und robuster Verhandlungsdiplomatie der USA gefeiert. Schon bald stellte sich angesichts der langsamen Implementierung allerdings Ernüchterung ein. Politischer Zwist und dysfunktionale Staatstrukturen behindern seither den Aufbau einer stabilen Friedensordnung.
Unter welchen Bedingungen wurde der Friedensschluss möglich? In Bosnien-Herzegowina entstand im Spätsommer 1995 eine militärische Pattsituation. Die Kriegsparteien – die bosnischen Serben auf der einen Seite und die kroatisch-bosniakischen Streitkräfte auf der anderen – hielten jeweils etwa die Hälfte des Staatsgebiets. Keine der Parteien konnte noch mit bedeutenderen Geländegewinnen rechnen. In diesem „reifen Moment“ präsentierte der US-Sondergesandte Richard Holbrooke einen Friedensplan, der die im Kern unvereinbaren Ziele der Kriegsparteien auf einen gemeinsamen Nenner brachte. Zu den Bedingungen des Friedens gehörte also auch ein Friedensplan, der eine neue politische Ordnung schuf und einen Modus vivendi für den multiethnischen Staat entwarf. Ebenso hatte sich bei den Patronen der kriegführenden Parteien, Serbien und Kroatien, Ermüdung eingestellt. Die in Dayton präsentierte Lösungsformel lautete: Bosnien-Herzegowina blieb in seinen Vorkriegsgrenzen als einheitlicher Staat erhalten, wurde aber in zwei weitgehend unabhängige Bundesstaaten, die Entitäten, zerlegt und mit einer hochkomplexen föderalen Verfassung ausgestattet. Gleichzeitig wurde Serben und Kroaten erlaubt, Sonderbeziehungen mit ihren „Mutterländern“ zu unterhalten. Ein mit diktatorischen Gewalten ausgestatteter Hoher Repräsentant wacht seitdem über die Umsetzung des Abkommens.
Der 1995 geschlossene Friedensvertrag von Dayton hat Schlimmeres, nämlich den Fortgang des Krieges, verhindert. Allerdings hat er bestehende Konflikte lediglich eingefroren, nicht wirklich lösen bzw. transformieren können. Nach einem Vierteljahrhundert sind die Interessen- und Ziele der Parteien, die damals zum Krieg führten, im Grundsatz unverändert. Zum Teil sind sogar die Akteure dieselben. Sie waren damals bereit, die Kriegshandlungen einzustellen, haben den Konflikt seither aber mit nichtmilitärischen Mitteln fortgeführt. So ist das Land über zwanzig Jahre nach Ende des Krieges ethnisch, politisch, institutionell und mental tiefer gespalten denn je, ein gemeinsames Staatsverständnis gibt es nicht. In den letzten Jahren ist sogar eine stetige Verschlechterung der innerstaatlichen Beziehungen festzustellen. Führende Politiker der Republika Srpska propagieren offen die Auflösung Bosnien-Herzegowinas; kroatische Nationalpolitiker fordern unterdessen den Umbau der föderalen Ordnung zugunsten einer dritten, kroatischen Entität. Somit hat das Dayton-Abkommen zwar den heißen Krieg beendet. Aber der Friede wurde seither immer noch nicht gewonnen.